Verschickungskinder – Schein vs. Realität
Zum AnfangVerschickungskinder
Weitere Informationen
EIN PROJEKT DER HOCHSCHULE DER MEDIEN STUTTGARTLara Bräuning, Aline Hartmann, Valentina Herzog, Christina Laue, Jana Trenner
Nobelstraße 10
70569 Stuttgart
Danke!
Ein großes Dankeschön an unsere Interviewpartnerinnen, die uns ihre Geschichten anvertraut und uns unterstützt haben, wo sie nur konnten.
In Kooperation mit:
Thematik Verschickungskinder
Zum Anfang Zum Anfang„Alles war fremd. Ich war wie abgeschnitten von allem was ich kannte und was mir vertraut war.“– Stefanie, ehemaliges Verschickungskind
Trügerische Idylle
„Den Eltern wurde vorgegaukelt, dass es einem gut geht.“ Sie sollten nichts von den Umständen wissen. So wurde den meisten Kindern damals auch nicht geglaubt und Misshandlungen sowie andere Missstände wurden jahrzehntelang ignoriert. Dabei leiden einige noch heute an psychischen Problemen wie Angststörungen, Schuldgefühlen oder Platzangst.
WEITERE INFORMATIONEN
SWR Doku
Erniedrigung statt Erholung – Wie Kinder in Kurheimen erniedrigt und traumatisiert wurden. Ein Bericht von REPORT MAINZ über Kinderkurheime zur Erholung, in denen die Kinder gequält und misshandelt wurden.
Dokus im Ersten
Gequält, erniedrigt, drangsaliert – Der Kampf ehemaliger Kurkinder um Aufklärung. Eine Doku im Ersten über sogenannte Erholungskuren. Die ehe- maligen Verschickungskinder leiden oft noch heute an den Folgen.
Heimerziehung – Albtraum Kinderkur
Ein Bericht vom Deutschlandfunk über die Recherche der Tochter eines Betroffenen. Gewalt, sexuelle Übergriffe und Drangsalier- ungen passierte vielen, die in staatlichen und kirchlichen Heimen Urlaub machten.
Initiative Verschickungskinder
Quellen 1
Quellen
https://www.swr.de/report/erniedrigung-statt-erholung-wie-kinder-in-kurheimen-gequaelt-und-traumatisiert-wurden/-/id=233454/did=24601462/nid=233454/6q0wyx/index.html
Neumann, U. (2019b). REPORT MAINZ: Erniedrigung statt Erholung – Wie Kinder in Kurheimen gequält und traumatisiert wurden (Teil 2). Das Erste. Abruf am 01.07.2021 von
https://www.swr.de/report/erniedrigung-statt-erholung-wie-kinder-in-kurheimen-gequaelt-und-traumatisiert-wurden/text-des-beitrags-erniedrigung-statt-erholung/-/id=233454/did=24601462/mpdid=24772866/nid=233454/1bm1c6g/index.html.
nexus – Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung (2020). Heimstatistiken Verschickungsheime jetzt online. Abruf am 01.07.2021 von
https://nexusinstitut.de/heimstatistiken-verschickungsheime-jetzt-online/.
Röhl, A. (2021). Das Elend der Verschickungskinder: Kindererholungsheime als Orte der Gewalt. Gießen: Psychosozial-Verlag.
Röhl, A. (2021). Die Initiative Verschickungskinder– aktuelle Situation und Handlungsbedarf. Abruf am 01.07.2021 von
https://verschickungsheime.de/wp-content/uploads/2021/06/MMST17-3975.pdf.
Verein Aufarbeitung und Erforschung von Kinder-Verschickungen e.V. (2020a). Heimstatistiken. Verschickungsheim – Das vergessene Trauma. Abruf am 02.07.2021 von
https://verschickungsheime.de/heimstatistiken/.
Verein Aufarbeitung und Erforschung von Kinder-Verschickungen e.V. (o.D.). Verschickung-Definition – Verschickung in Kinderkur- und -Erholungsheime. Verschickungsheim – Das vergessene Trauma. Abruf am 01.07.2021 von
https://verschickungsheime.de/verschickung-definition/.
Verein Aufarbeitung und Erforschung von Kinder-Verschickungen e.V. (2020b). Verschickungen (von 1950-1990) ein Trauma bis heute?. Verschickungsheim – Das vergessene Trauma. Abruf am 02.07.2021 von
https://verschickungsheime.de/verschickungen-von-50-90-ein-trauma-bis-heute/.
Geschichte 1
Lisa – 7 Jahre alt
Der Arzt hatte ihr für ihre Wachstumsschmerzen in den Beinen und das Untergewicht die Kur verschrieben und dort war sie dann auch – sechs Wochen lang. Trotz der Vorbereitungen durch Lisas Mutter waren die Aktivitäten in der Kur seltsam – die Solebäder, das Spazieren und vor allem, dass trotz sechs Wochen ohne Schule wenig Zeit zum Spielen übrig blieb. Mit sieben Jahren so weit weg von zu Hause. Lisa wurde von ständigem Heimweh geplagt. Die Stütze für das kleine Mädchen waren die Briefe der Familie. Einmal pro Woche durfte sie einen Brief oder eine Postkarte nach Hause schicken – zu ihrem Glück bekommt sie von ihrer Familie und ihren Freunden eine Menge Briefe zurück. Denn auch Lisas Mama weiß aus erster Hand, wie befremdlich sich ein Kuraufenthalt anfühlen kann. Die Briefe waren ihr Versuch, das Heimweh der kleinen Lisa aus der Ferne ein Stück besser zu machen. Pakete und Besuche bleiben dem jungen Mädchen verwehrt. Die Briefe der Familie halfen Lisa ein Gefühl für Zeit zu behalten und sich trotz aller Umstände im Kurheim einzuleben.
Die Macht des Heimwehs BRIEFE DER ELTERN ALS ANKER
Die Macht des Heimwehs BRIEFE DER ELTERN ALS ANKER
Geschichte 2
Zum Anfang Zum AnfangEin Hilfeschrei in andere Welten
Der Brief an die Eltern – 39 Jahre später
Die ganze Wahrheit
heute schreibe ich Euch wieder mal aus dem Kurheim. Hier ist alles anders als zu Hause. Das Essen schmeckt komisch, überhaupt nicht wie zu Hause und die Leute sprechen ganz seltsam. Ich verstehe sie oft nicht. Es sieht auch alles anders aus, die Häuser, die Straßen, die Landschaft, das habe ich schon auf der Fahrt hierher bemerkt. Das Kurheim, ein großes Haus von außen weiß gestrichen, aber innen sehr dunkel. Vor allem die Flure und das Treppenhaus, das zu den Schlafräumen führt. Überall knarzt der Boden, wenn man darüber geht. Herumrennen oder toben dürfen wir nicht. Es ist alles so groß und ich fühle mich ganz klein. Eigentlich sollten hier 30 Kinder sein, aber weil das Heim bald geschlossen wird, sind wir nur sehr wenige. Das macht das Ganze noch unheimlicher.
Ich fühle mich hier sehr fremd und auch wenn manche „Tanten“ sich gelegentlich bemühen, nett zu sein, zum Beispiel Frau Rabe, habe ich doch immer ein bisschen Furcht vor ihnen. Am meisten Angst habe ich vor Frau Rauch, das ist die Heimleiterin, sie ist sehr streng und ich habe in ihrer Anwesenheit immer das Gefühl, das ich alles falsch mache und bin ständig auf der Hut.Alle Erwachsenen hier sind ganz alt, ich glaube mindestens 70! Frau Rauch und Frau Rabe und Herr Richter, er ist wohl so eine Art Helfer für alles. Die Köchin ist etwas jünger, aber nicht besonders nett. Vor allem nicht, wenn man nicht aufisst. Wir müssen immer alles aufessen. Heute gab es Milchreis mit Zimt und Zucker, das habe ich noch nie gegessen. Bäh. Eklig. Es sah aus wie dicke Maden in Milchsoße und fühlt sich im Mund auch so an. Mir wurde übel, als ich das essen musste und ich musste mich konzentrieren, dass ich es nicht wieder ausspuckte oder würgte.
Das habe ich hier schon gelernt, dass ich alles runterschlucke, auch wenn ich keinen Hunger habe oder das Essen absolut nicht mag oder gar eklig finde. Denn sonst muss ich am Tisch sitzen bleiben, bis ich alles aufgegessen habe. Da sitzt man dann ganz alleine in dem großen Speisesaal. Am besten klappt es, wenn ich kleine Happen in den Mund stecke und sie schnell runterschlucke, ohne zu kauen. Dann schmeckt man am wenigsten und bekommt den Teller schneller leer.
Die Kinder sind natürlich nicht so alt, sondern ungefähr so alt wie ich. Aber wie gesagt, es sind nur wenige. Manchmal sind wir zwei oder drei, dann auch mal für kurze Zeit vier. Denise Günthner, Mario, Martin, Joachim. Wir Kinder verstehen uns meistens ganz gut, mit Denise habe ich mich etwas angefreundet. Aber selbst Denise kann ich mich nicht wirklich anvertrauen und ihr scheint es ähnlich zu gehen.
Ich bin hier ständig unter Beobachtung, man kann nicht alleine sein. Wir Kinder sind eigentlich nie unter uns. Immer ist eine Betreuerin dabei. An meinem Geburtstag durfte ich ja mit Euch telefonieren, aber auch da stand eine Betreuerin oder Frau Rauch daneben und ich konnte nicht sagen, was ich sagen wollte. Das hat mich sehr traurig und hilflos gemacht. Auch beim Briefeschreiben ist natürlich jemand dabei und liest die Briefe bevor sie verschickt werden. Diesen Brief schreibe ich nur in meinen Gedanken, denn die Angst, beim heimlichen Schreiben erwischt zu werden, ist einfach zu groß.
Mir fehlt die Freiheit von zu Hause, dass ich einfach herausgehen kann, alleine und mit Freunden unterwegs zu sein, in den Straßen, die ich kenne und in dem Nachbargarten Fahrrad fahren, schwimmen, Fußball oder Federball spielen. Hier gehen wir gemeinsam spazieren, so etwas Langweiliges. Manchmal gehen wir zur Rupertskapelle, manchmal ins Dorf oder einfach so in der Landschaft herum. Einmal haben wir eine kleine Schneeballschlacht gemacht, das war lustig und ich habe kurz vergessen, dass ich mich hier nicht wohlfühle. Es wurde ein Foto mit meinem Fotoapparat gemacht und dann war der Spaß auch schon wieder vorbei.
Alleine bin ich dann beim „Mittagsschlaf“, den wir zwangsweise machen müssen. Jeder alleine in seinem Zimmer. Dort liege ich dann wach herum und langweile mich zu Tode. Nicht mal lesen dürfen wir! Aus lauter Langeweile habe ich meine Lippen an die kalte Wand gepresst und Spucke auf die Wand laufen lassen. Dann habe ich beobachtet, wie sie langsam herunterläuft. Wenn es mehr Spucke war, lief es schneller und überholte manchmal einen langsamen Tropfen. Ich stellte mir vor, wie sich unter dem Bett ein ganzer See sammeln würde … Ein See aus Spucke, allerdings könnte er auch aus Tränen bestehen, denn Weinen tue ich oft am Abend. Ganz alleine in meinem Bett, meinem Zimmer.
Wir haben nachts unterschiedliche Schwestern, die aufpassen, dass wir ruhig sind. Alle bis auf eine sind sehr streng und haben mich ermahnt, als ich einmal etwas lauter geweint habe vor Heimweh. Seitdem weine ich so leise wie möglich. Nur eine der Schwestern, Schwester Angela, zeigt etwas Verständnis für mein Heimweh. Ich darf manchmal sogar zu ihr ins Zimmer kommen und mich kurz zu ihr setzen. Sie sagt mir dann nicht in kaltem Ton, dass ich gefälligst in mein Zimmer gehen soll und schlafen soll, sondern sie scheint mich zu verstehen, und ich finde sogar ein wenig Trost bei ihr. Aber immer darf ich das auch nicht.
Mama, Papa, Bestrafungen gibt es hier auch. Wenn man nicht gehorcht zum Beispiel, muss man die Mittagspause auf der Holzbank im Speisesaal verbringen. Das musste ich schon einmal. Die Mittagspause, die mir auch im bequemen Bett schon lang erschien, wurde so zu einer Ewigkeit. Überhaupt der Aufenthalt hier kommt mir vor wie das ganze Leben. Acht Wochen soll ich hierbleiben, wisst ihr, wie lang das ist? Ich bin gerade erst 10 Jahre alt! Es fühlt sich an, als würde ich nie wieder nach Hause kommen. Aber ich will hier nicht mehr bleiben!
Ich vermisse Euch so sehr, ich vermisse alles von zu Hause, sogar meine kleine Schwester! Und mein Zimmer, meine Freundinnen Ina, Insa, Oma und Opa, unseren Garten, die Schule. Und ich will da wieder hin, nach Hause, in die Schule, zu meinen Freunden, wo ich hingehöre!Warum kann ich nicht nach Hause? Ich will hier weg, will wieder zu Euch. Oder wollt ihr mich gar nicht mehr? Habe ich etwas falsch gemacht? Wollt ihr mich bestrafen, indem ihr mich hierher geschickt habt? Seid ihr froh, dass ich endlich weg bin? Ich will unbedingt zu Euch, ganz schnell. Könnt ihr mich nicht abholen? Bitte holt mich schnell ab! BITTE!
In großer Liebe,
Eure Stefanie“
Geburtstag im Kurheim
Geschichte 3
Zum Anfang„Doch bitte holt mich ab, sonst weine ich“– Angelika, ehemaliges Verschickungskind
Die Inhalte der Karte
Anders als andere Verschickungskinder durfte Angelika auf die Karte schreiben, was sie wollte. So konnte sie ihre Mutter kontaktieren und vorzeitig abgeholt werden. Doch eines stellt sie auch klar – „sie wäre schwer zu überzeugen gewesen“, etwas anders zu schreiben.
Schreibzeiten
Auch in der kurzen Zeit kann sich Angelika erinnern, „mindestens einmal pro Woche“ an ihre Eltern schreiben zu müssen. Ob öfter erlaubt war, kann sie heute nicht mehr sagen.
Der Ort der Postkarten
Alle Kinder fanden sich also einmal in der Woche in dem Raum zusammen, den Angelika eigentlich von den Mahlzeiten kannte.
Die Karte als Hilferuf
Schon nach der ersten Woche war für Angelika klar – „hier ist es ganz anders, als sie sich das vorgestellt hatte“. Mit Nachdruck und Traurigkeit betonte sie in ihrer Postkarte, dass sie wieder von hier weg möchte.
Achtung Postkontrolle!
Dass die Post im Kurheim kontrolliert wurde, sprach sich bald herum. Schon mit 10 Jahren wusste Angelika, dass Briefe anderer Menschen zu lesen „eine Unverschämtheit“ ist.




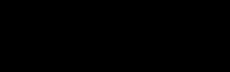



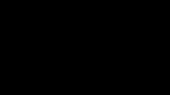






































 Verschickungskinder
Verschickungskinder
 Verschickungskinder
Verschickungskinder
 Verschickungskinder erzählen
Verschickungskinder erzählen
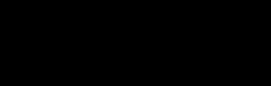 EIN PROJEKT DER HOCHSCHULE DER MEDIEN STUTTGART
EIN PROJEKT DER HOCHSCHULE DER MEDIEN STUTTGART
 Daten & Fakten
Daten & Fakten
 Daten & Fakten
Daten & Fakten
 „Alles war fremd. Ich war wie abgeschnitten von allem was ich kannte und was mir vertraut war.“
„Alles war fremd. Ich war wie abgeschnitten von allem was ich kannte und was mir vertraut war.“
 Trügerische Idylle
Trügerische Idylle
 Lisa – 7 Jahre alt
Lisa – 7 Jahre alt
 Dialog zwischen Kind und Familie 1
Dialog zwischen Kind und Familie 1
 2
2
 3
3
 4
4
 5
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 Die Macht des Heimwehs
Die Macht des Heimwehs
 Die Macht des Heimwehs
Die Macht des Heimwehs
 Stefanie – 9 Jahre alt
Stefanie – 9 Jahre alt
 Stefanie – 9 Jahre alt
Stefanie – 9 Jahre alt
 Ein Hilfeschrei in andere Welten
Ein Hilfeschrei in andere Welten
 Der Brief an die Eltern – 39 Jahre später
Der Brief an die Eltern – 39 Jahre später
 Die ganze Wahrheit
Die ganze Wahrheit
 Geburtstag im Kurheim
Geburtstag im Kurheim
 Angelika – 10 Jahre alt
Angelika – 10 Jahre alt
 „Doch bitte holt mich ab, sonst weine ich“
„Doch bitte holt mich ab, sonst weine ich“
 Ablauf: Schreiben von Postkarten
Ablauf: Schreiben von Postkarten
 Post von Zuhause
Post von Zuhause
 Ute – 4 Jahre alt
Ute – 4 Jahre alt
 Ute – 4 Jahre alt
Ute – 4 Jahre alt
 Unausgesprochene Worte
Unausgesprochene Worte
 Zurückgelassen und ausgesetzt
Zurückgelassen und ausgesetzt
 Zurückgelassen und ausgesetzt
Zurückgelassen und ausgesetzt
 Birgit – 3, 6, 9, 11 & 12 Jahre alt
Birgit – 3, 6, 9, 11 & 12 Jahre alt
 Viel geschrieben – nichts gesagt
Viel geschrieben – nichts gesagt
 Max und Moritz im Kurheim
Max und Moritz im Kurheim
 Wenn die Wahrheit ans Licht kommt
Wenn die Wahrheit ans Licht kommt